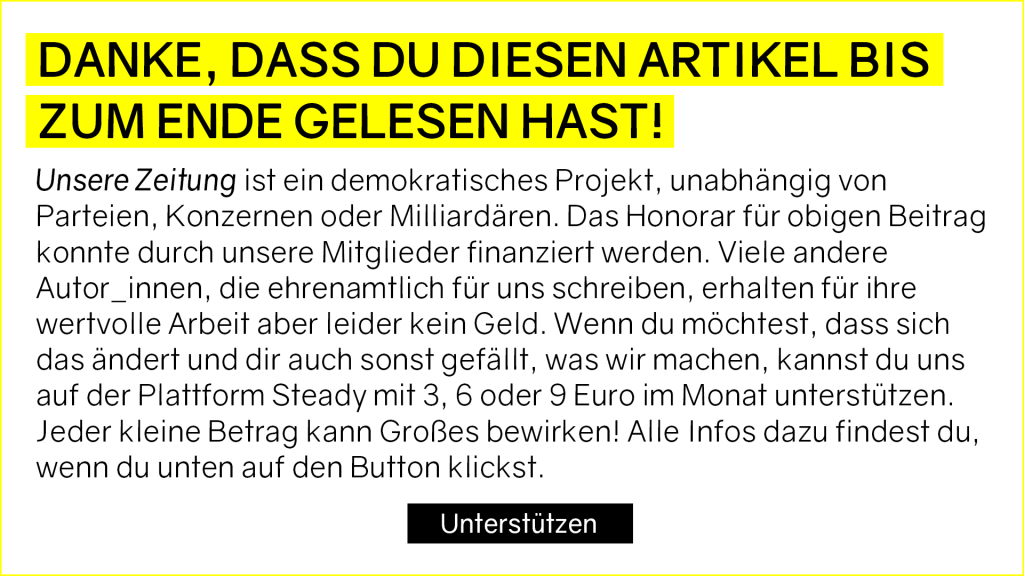Die Stunde des Parlaments
Eigentlich ist das Parlament als Tribüne der Öffentlichkeit konzipiert. In der Coronakrise wird aber mehr denn je auf eine exekutivistische Politik mittels Pressekonferenzen gesetzt. Die Bürger_innen über die weitreichenden Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte und die Meinung der Opposition hierzu in Pressefoyers ohne Debatte lediglich zu unterrichten, wird der parlamentarischen Demokratie nicht gerecht.
Von Tamara Ehs

Damit die in der Lockdown-Verordnung vorgesehenen Ausgangsbeschränkungen und das Betretungsverbot von Betriebsstätten Rechtswirksamkeit erlangen, muss gemäß § 11 des im September novellierten COVID-19-Maßnahmengesetzes das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats gesucht werden. Dieses Mitspracherecht hatte sich die SPÖ damals für ihre Zustimmung ausbedungen.
In jenem Hauptausschuss, der am Sonntagnachmittag zusammentrat – und der die Ausgangsbeschränkungen alle zehn Tage verlängern muss, sollen sie den gesamten November über gelten –, genügt jedoch eine einfache Mehrheit und somit die Einstimmigkeit der Regierungsparteien. Ein Veto der Opposition ist nicht möglich. Um massivste Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte zu genehmigen, genügte also eine Stunde im Parlament hinter verschlossenen Türen mit nachfolgender Pressekonferenz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.
Einer parlamentarischen Demokratie würde es allerdings gut anstehen, wenn die Regierung den Lockdown im Rahmen einer Sondersitzung des Nationalrats ankündigen und gegenüber der Opposition in Rede und Gegenrede öffentlich verteidigen müsste. Die Politikwissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von der „Tribünenfunktion“ des Parlaments. Insbesondere der Nationalrat stellt den Ort dar, an dem Debatten und Entscheidungen öffentlich werden müssen.
„Hier ist die Regierung verpflichtet, zu kommen, Rede und Antwort zu stehen und sich den parlamentarischen Verhaltensregeln zu unterwerfen. Dies ist von so großer Bedeutung, weil es für den Bereich der Regierungen und Verwaltungen keine Tradition (und Theorie) der Öffentlichkeit und geregelten Debatte gibt“, erinnert der Mitarbeiter der Parlamentsdirektion, Christoph Konrath, in unserem Kritischen Handbuch der österreichischen Demokratie.
Es fehlt in Österreich an öffentlicher Diskussion, was umso schwerer wiegt, zumal auch das Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz noch immer auf sich warten lässt. Bislang liegt Österreich im Global Right to Information Rating nämlich konstant auf dem allerletzten Platz. Auch die Arbeit der Corona-Taskforce ist noch immer unter Verschluss. Die jüngste öffentlich einsehbare Mitschrift stammt vom 9. April. Als Bürgerinnen und Bürger können wir also kaum nachvollziehen, auf welcher Grundlage die politischen Entscheidungen beruhen.
Dabei handelt sich nicht um bloße Neugierde, sondern um eine Voraussetzung des demokratischen Rechtstaates. Der Verfassungsgerichtshof hob bereits etliche Corona-Verordnungen auf, weil er ihre Begründung nicht nachvollziehen konnte: „Bei allen als gesetzwidrig erkannten Bestimmungen war aus den dem VfGH vorgelegten Akten nicht nachvollziehbar, auf Grund welcher tatsächlichen Umstände die zuständige Behörde – der Gesundheitsminister – die jeweilige Maßnahme für erforderlich gehalten hat. Dies verstößt aber gegen die gesetzliche Ermächtigung im COVID-19-Maßnahmengesetz bzw. im Epidemiegesetz.“
Der VfGH beurteilt nicht die inhaltliche Richtigkeit der Maßnahmen, sondern ihr Zustandekommen, das im Rechtstaat begründet werden muss. Der Rechtswissenschafter Konrad Lachmayer von der Sigmund Freud-Universität weist darauf hin: „Begründungen für die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sind notwendig, erfolgen derzeit aber nicht öffentlich.“. Für die Herstellung von Öffentlichkeit sind Ankündigungs- und Verkündigungs-PK zu wenig. Die Demokratie verlangt nach schriftlichen Unterlagen, nachvollziehbaren Begründungen und einer Debatte. Sondersitzungen des Nationalrats oder wenigstens die Öffentlichkeit des Hauptausschusses könnten dabei helfen.
Dass Krisenzeiten die „Stunde der Exekutive“ sind, ist nämlich in der Verfassung nicht vorgesehen. Vielmehr hatte das Parlament und insbesondere die Opposition durch die Zustimmung zu umfassenden Ermächtigungsgesetzen schon im Frühjahr das Ruder aus der Hand gegeben und es bis heute verabsäumt, einen „Coronaauschuss“ als begleitendes Kontrollinstrument zu etablieren.
Mit solch einem Ausschuss, der gleichzeitig mit dem Allparteienbeschluss der Märzgesetze seine Arbeit hätte aufnehmen können, wäre es dem Nationalrat möglich, die COVID-19-Maßnahmengesetze einer ergänzenden kritischen Reflexion zu unterziehen. Vorzugsweise unter der Vorsitzführung einer_eines Oppositionellen hätte jener Ausschuss in Permanenz nach den wertenden Kriterien und Entscheidungsgrundlagen der Regierung gefragt und diese öffentlich gemacht.
Tamara Ehs ist Wissensarbeiterin für Demokratie und politische Bildung. Dabei berät sie auch Städte und Gemeinden in partizipativen und konsultativen Prozessen. Sie ist Trägerin des Wissenschaftspreises des österreichischen Parlaments. Soeben ist ihr neuestes Buch „Krisendemokratie“ (Wien: Mandelbaum Verlag 2020) erschienen.
Titelbild: © Parlamentsdirektion / Johannes Zinner